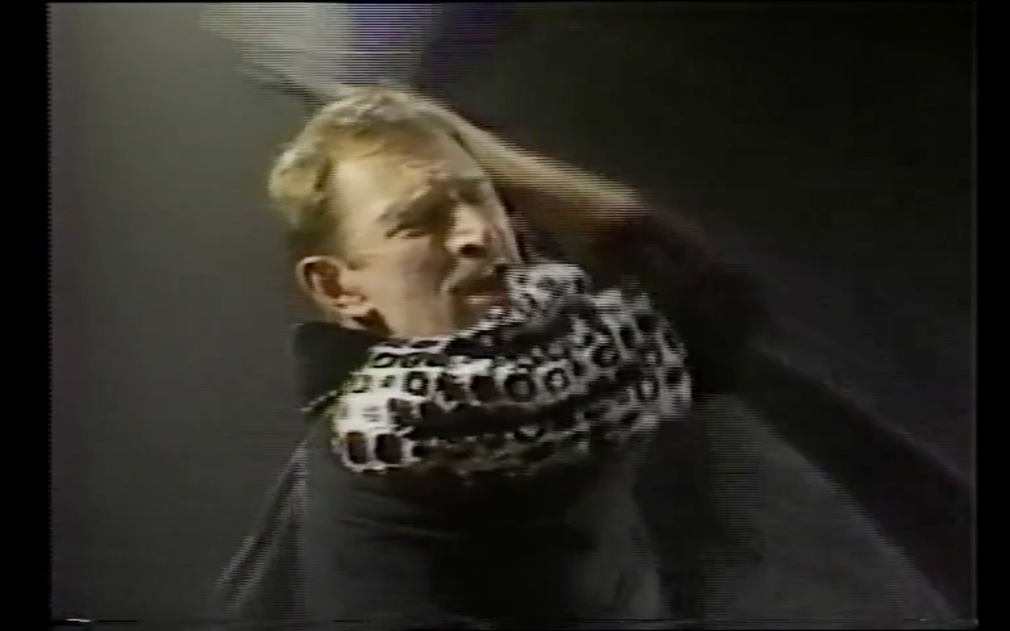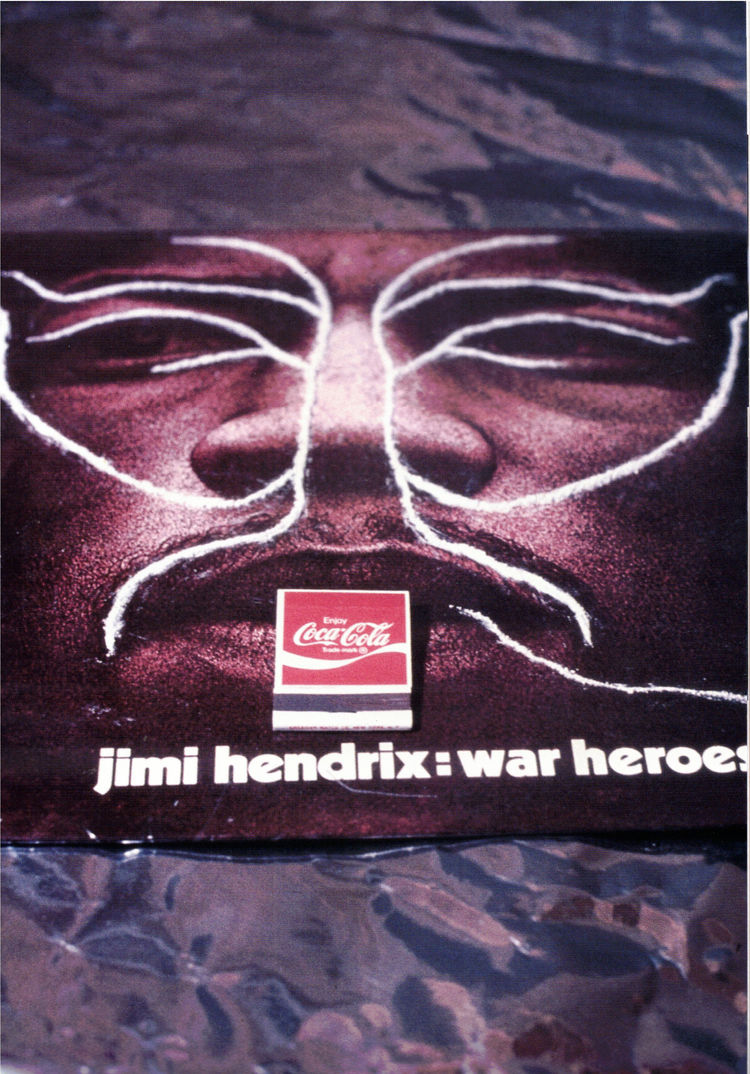José B. Segebre
Ästhetik des Wartens: Queere, feministische und dekoloniale Perspektiven
Fachbereich Kunst (Philosophie/Ästhetik)
Zeit ist keineswegs neutral, und Warten verschärft das Ungleichgewicht von Macht. Es gibt diejenigen, die warten, und diejenigen, die warten lassen. Warten ist Ausdruck unseres Verhältnisses zur Macht, und dieses Verhältnis ist durch soziale Markierungen bedingt. Vor diesem Hintergrund erscheint Warten immer als unterdrückend. Gleichzeitig kann es jedoch auch zu einer begehrenswerten Erfahrung werden. Auf den Bus zu warten, kann zum Beispiel nicht nur bedeuten, dass wir seine Ankunft erwarten, antizipieren und erhoffen, sondern auch, dass wir sie wollen. Der Haken dabei ist, dass wir nicht wissen, wann und ob er kommt, vor allem wenn er sich kontinuierlich verspätet. Es ist die Dauer des Wartens, die frustrierend und unterdrückend wirkt. So gesehen ist Warten eine ambivalente Zeitlichkeit, die deutlich macht, wie Zeit gegen sozial markierte Subjekte mobilisiert wird, um Unterdrückung zu internalisieren. Unter Rückgriff auf kritische, queere, feministische und dekoloniale Theorien verwende ich Warten als Prisma, um die Beziehung zwischen Zeitlichkeit und Macht in der Ästhetik zu untersuchen.
Die performativen künstlerischen Praktiken von Jack Smith (1932-1989), Ana Mendieta (1948-1985) und Lorraine O'Grady (1934- ) sind in dieser Auseinandersetzung richtungsweisend. Warten wird in diesen nicht illustriert oder repräsentiert, sondern auf je unterschiedliche Weise zur Geltung gebracht. Smiths Performances ohne erkennbaren Beginn oder Schluss zögern Zeit hinaus, Mendietas Bewegtbildarbeiten lassen Zeit aussetzen und O'Gradys Interventionen unterbrechen den gewohnten Fluss von Zeit. Der Schwerpunkt auf das Warten revidiert dabei vorhandene Interpretationen ihrer Werke. Die Formen des Wartens, die durch Aufschübe, Verweigerungen, Verdrängungen und Unterbrechungen von den drei Künstler*innen produziert werden, verwandeln das Warten und schließen so dessen Register der Unfreiheit mit ein. Solche künstlerischen Strategien lassen die Zeit des Wartens so lustvoll, wirkungsvoll und kontemplativ ausfallen, dass ein bedeutendes Potential für Queerness freigelegt wird. Eine Ästhetik des Wartens befasst sich mit dem, was José E. Muñoz als "hopeless hope", Sara Ahmed als "hopeful anxiety" und Theodor Adorno als "vergebliches Warten" bezeichnet haben. Diese Modi des Wartens rücken unser Verhältnis zur Zukunft in ein queeres Licht. Sie verweisen auf das Potential zeitbasierter Künste, den vermeintlichen Zwang der Zeitpolitik des Wartens zu durchbrechen. Eine Ästhetik des Wartens liefert kein Narrativ heroischer Befreiung oder Revolution, sondern mobilisiert stattdessen kurze intervallische Momente des Widerstands und kollektiver Zusammenkünfte gegen die Beständigkeit von Machtstrukturen.
-José B. Segebre
Schlüsselwörter: Ästhetik, Kunstgeschichte, Critical Race Theory, Dekolonialismus, Feminismus, Filmwissenschaft, Queer Studies, Performance Kunst, Phänomenologie, Psychoanalyse, Macht, Zeitlichkeit, Warten
Betreuer*innen:
1. Prof. Dr. Juliane Rebentisch, Professur für Philosophie/Ästhetik, Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main,
2. Prof. Dr. Marc Siegel, Professur für Filmwissenschaft, Johannes Gutenberg Universität Mainz,