Im Wattenmeer
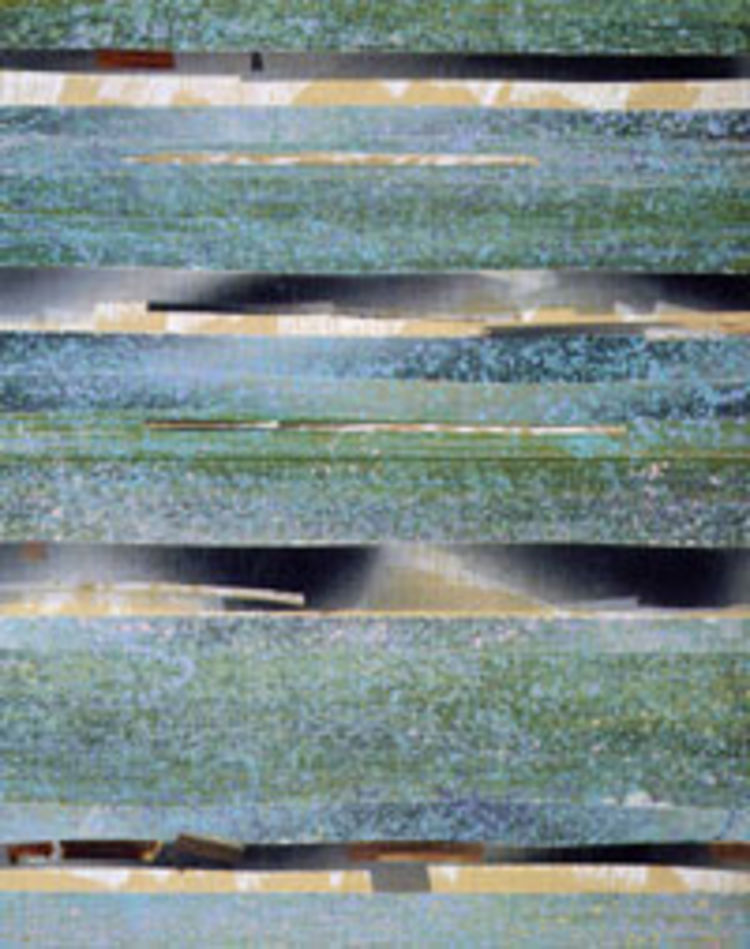
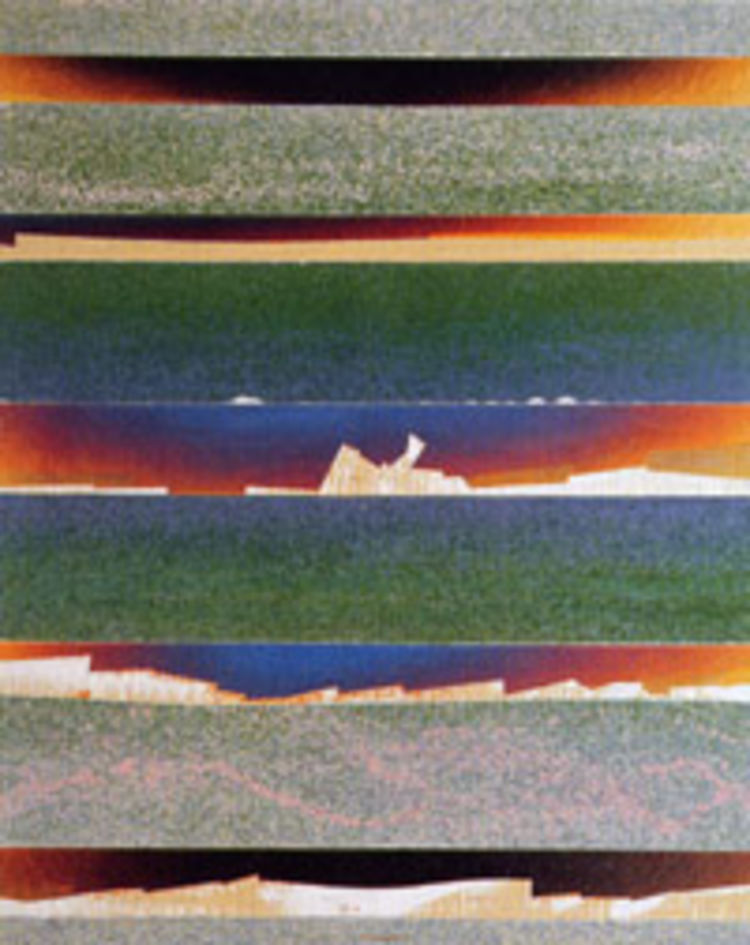
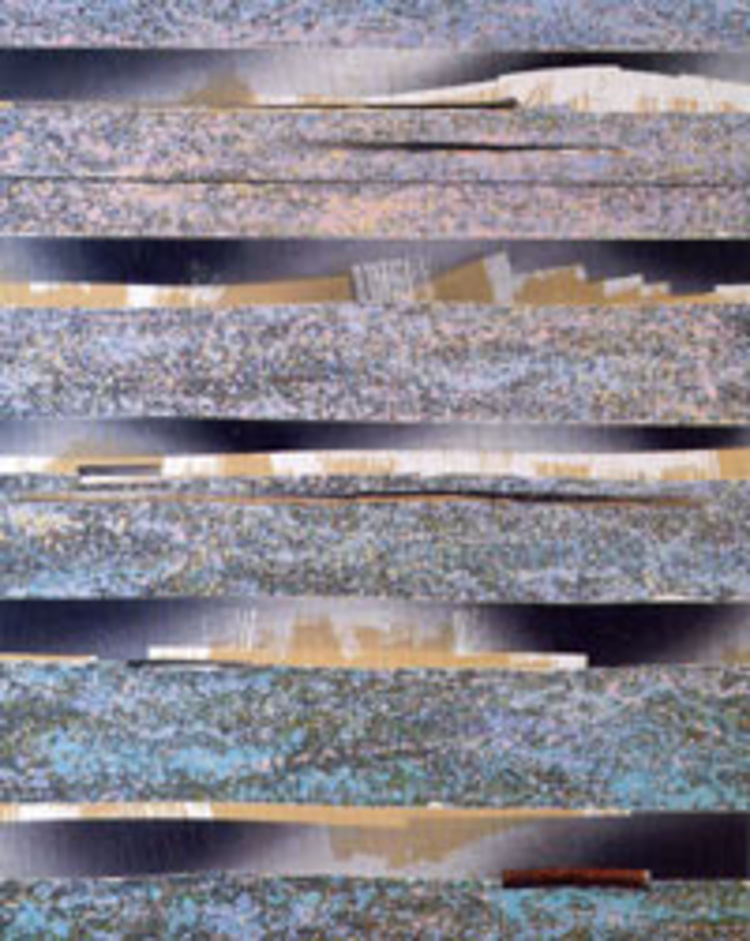
Ausstellung von Adam Jankowski »Im Wattenmeer - 3 Landschaften« im Foyer des Altonaer Museums
Eröffnung der Installation während der Zweiten »Langen Nacht der Hamburger Museen« am Sonnabend, dem 25. Mai 2002, um 19:30 Uhr
Die Idee zur Präsentation einer Arbeit von Adam Jankowski im Foyer des Altonaer Museums entstand im Gespräch zwischen dem Künstler und dem Direktor des Museums. Beide waren sich einig, dass die Gegenwart zeitgenössischer Kunst im Eingangsbereich eines volks- und landeskundlich ausgerichteten Museums als programmatisch für eine neue Sichtweise empfunden werden kann - aber nicht muss, denn alle übrigen Bereiche des Museums bleiben davon unberührt. Sie ist aber auch nicht deplaciert, denn das Altonaer Museum zeigt und sammelt Kunst bis in die Gegenwart, wenn sie mit der norddeutschen Landschaft und mit den sie umgebenden Meeren in Beziehung steht.
Dass Jankowski etwas aus diesem Themenkreis parat haben könnte, lag angesichts seiner Meerlandschaften der 90er Jahre nahe. Tatsächlich hatte er das Thema »Watt« am Ende des Jahres 2001 gerade in Arbeit. Er hat den Wunsch nach einem Triptychon für die Eingangshalle wie eine Auftragsarbeit behandelt, obwohl sie dies aufgrund fehlender finanzieller Möglichkeiten des Museums nicht ist, und so entstand ein für die Wand des Foyers neu konzipiertes dreiteiliges Werk. Es soll einen zeitgenössischen Blick auf die maritimen Themen des Museums vermitteln und so den Außenraum unseres Alltags mit den historischen Sammlungen verbinden.
Nicht nur an diesem besonderen Ort sondern grundsätzlich entsteht Jankowskis Kunst in einem Schwebezustand konträrer Erfahrungswerte und kunsttheoretischer Ansätze. So konkret und gegenständlich die Bildtitel, so theoretisierend und abstrakt ist die künstlerische Durchführung. Er zeigt keine naturalistische Wattlandschaft, die sich etwa aus detailreichem Vordergrund in eine Bildtiefe aus Sand, Wasser und Himmel verlieren könnte. Sondern er baut jedes der drei Gemälde aus zahlreichen horizontal angeordneten Bildstreifen auf, in denen sich die Materie des Watts, Spiegelungen und Lichtphänomene im Wasser und in Öllachen in abstrakten und hart von einander abgesetzten Farbwelten konkretisieren.
So wie sich in der Natur unter schnell ziehenden Wolken, im Früh- oder Abendlicht oder bei wechselndem Wetter Farbeindrücke laufend verändern, so vermittelt jedes der drei Gemälde unterschiedliche Farbtemperaturen und Stimmungen. Hierzu tragen auch die unterschiedliche Streuungsdichte in den gesprühten Farbstreifen und die variierende Kantig- oder Flächigkeit der prismatischen Lichtbrechungen bei. In ihnen mögen sich utopische Architekturen eines neuen Morgens oder nur ferne Steilküsten spiegeln. Die Form des Triptychons - drei Altarflügel zu einem Thema – sakralisiert jede Naturstimmung für sich.
Jankowski entwickelte seine Theorie einer realistischen Malerei seit den siebziger Jahren aus abstrakten fotografischen Strukturen und der Übertragung naturwissenschaftlich verifizierter optischer Phänomene in eine Form der Malerei, die mit der Sprühpistole und den von ihr aufgetragenen feinen Farbpartikeln dichter an den modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen schien und mit der er zugleich die Unschärfen der modernen Phänomenologie darstellen konnte. Er bringt Mikro- und Makrokosmos »aus unserer 1:1-Wirklichkeit auf einer Leinwand als simultan wahrzunehmende Realität zusammen, auch dies mit der Absicht, die Relativität der Dinge darzustellen« (A.J., 2000).
Jankowski nutzt die modernen Erkenntnis-, Darstellungs- und Kommunikationswege, weil sie seiner Zeit und seinem Erkenntnisstand entsprechen, bricht sie aber ab, wenn sie in Getöse und Hypertrophie ausarten. Er schaltet das Fernsehbild ab, unterbricht das Gespräch und setzt sich in die Einsamkeit der Naturbeobachtung ab, wenn dies der Erkenntnis dienlicher ist - hierauf deutet auch das Zitat im Statement des Künstlers. Die Abrisskante, die die Segmente seiner Bilder scharf voneinander trennt und zugleich eine tiefere Malschicht freilegt, ist möglicherweise hierfür Symbol.
Axel Feuß
Adam Jankowski: Herr Feuß, Sie fragen mich, warum ich heute, also im Zeitalter des alles verhüllenden Rauschens der Fernsehstationen, der technischen Reproduzierbarkeit des Menschen ... Bilder über das Wattenmeer male? Diese Frage kann ich wohl am treffendsten mit einem Hinweis auf die Überlegungen des Kapitäns des Forschungsschoners »L´lndien« beantworten, wie sie dieser - laut Jean Gionos Erzählung »Die große Meerestille« - schon vor erheblicher Zeit seinem Schiffstagebuch anvertraut hat: »... Es kann nicht sein, dass das Leben nur das wäre, was wir bislang gelebt haben. Trotz unsres Jahrhunderts der Wissenschaft und des Fortschritts, den wir gemacht haben, lässt sich nicht bestreiten, dass wir vor Langeweile, vor Not, Trauer und Armut sterben. Ich spreche von der Armut der Seele und von der Armseligkeit des Wahrnehmbaren ... Ich bin kein Philosoph: ich langweile mich, wie alle Welt es tut. Der Anblick meiner Mitmenschen erweckt ganz einfach in mir jenes Gefühl der Verachtung, das so schrecklich ist durch das Gefühl der Absonderung, des Andersgeartetseins, das es sogleich im Gefolge hat. Und andererseits verachten andre die übrige Menschheit, der ich angehöre, und sind ebenso abgesondert und andersgeartet wie ich. Ich sehe nicht ein, welche Hilfe mir die bewohnte Erde leisten könnte, wenn ich nicht fähig bin, mir selber zu helfen. Deshalb lasse ich die Funkstation wohlverwahrt in ihrem Kasten ruhen; denn sie würde lediglich dazu dienen, auf ungeschickte Weise die Gespräche wieder aufzunehmen, die, selbst wenn sie sehr geschickt geführt würden, bislang noch keinen Menschen seiner Einsamkeit haben entrinnen lassen können.«