respekt of - Offenbacher People-Magazin
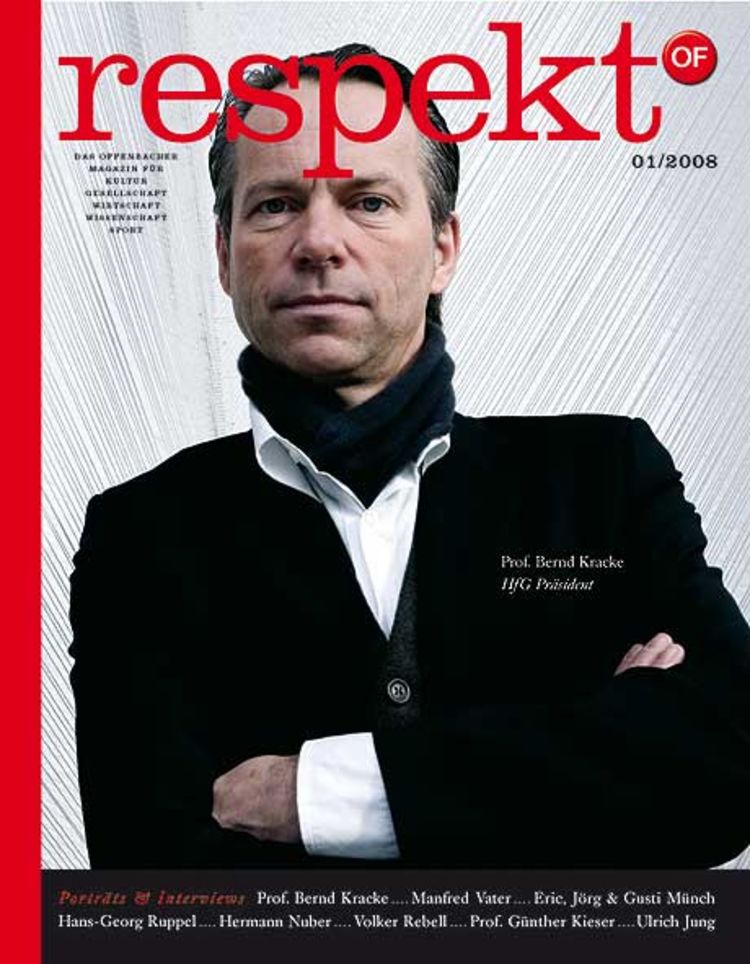
Interview mit Prof. Bernd Kracke aus der ersten Ausgabe von respekt of:
Wenn Politiker über Offenbach reden, dann verwenden sie immer wieder den Begriff von der Kreativstadt und verweisen gerne auf die Hochschule für Gestaltung als ihr Aushängeschild. Was halten Sie von dieser Verknüpfung?
Da ist viel dran. Auf der einen Seite ist Kreativität naturgemäß das zentrale Thema unserer Hochschule für Gestaltung. Insofern ist es gar nicht von uns zu trennen. Auf der anderen Seite muss so etwas im gesamten Stadtzusammenhang glaubhaft gelebt und auch politisch gewollt und unterstützt werden. Da gibt es auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial. Aber Offenbach ist nicht allein auf weiter Flur. Die Kreativwirtschaft wird auch von anderen Kommunen als wichtiger Standort- und Wirtschaftsfaktor erkannt. Plötzlich steht das Thema im Fokus. Man muss aber unterscheiden zwischen Kreativwirtschaft und Kreativszene. Letztere ist die substanzielle Triebkraft, die neue Ideen entwickelt und für Überraschungen sorgt. Die HfG ist das Biotop dieser Kreativszene aus Künstlern und Designern in Offenbach. Sie hat den notwendigen Stallgeruch, um für nachhaltige Glaubwürdigkeit zu sorgen und Ansiedlungen der Kreativwirtschaft zu fördern.
Muss dann nicht das gesamte Umfeld stimmen, und wo sehen Sie denn Defizite in Offenbach?
Das fängt ganz banal damit an, dass die Hochschule für Gestaltung in Offenbach nur schwer zu finden ist. Kaum Schilder und Hinweise im Stadtbild, sodass unsere Besucher und Gäste uns häufig verzweifelt suchen. Das zu verbessern ist eigentlich leicht. Aber viel wichtiger ist ein erweitertes kultur-politisches Bewusstsein. Es reicht nicht, nur mit Schildern auf die HfG hinzuweisen, sondern sie muss in eine Gesamtstrategie der Stadtentwicklung und des öffentlichen Auftritts eingebunden werden. Da gibt es noch viel zu tun, angefangen vom Logo über die Website bis hin zu speziellen Events für die Kreativszene.
Es fehlt ein tragendes Netzwerk?
Es gibt viele Netzwerke und viele Akteure in Offenbach. Aber so etwas muss wachsen, zusammenwachsen. Wir haben im vergangenen Jahr unser 175. Jubiläum gefeiert und in der Publikation „Gestalte/ Create“ deutlich die historischen Entwicklungslinien und die Herausforderungen für die HfG der Zukunft dargelegt. Dies war nur möglich durch das Zusammenwirken aller Lehrenden und Studierenden sowie durch die Einbeziehung unserer international erfolgreichen Absolventen. Ebenso maßgeblich waren die Unterstützung unserer Freunde, Partner und Sponsoren und die Kooperation mit Institutionen wie dem Museum für Angewandte Kunst Frankfurt. Das ist für mich ein Beleg, dass Networking mit Strahlkraft über Offenbach und die Rhein-Main-Region hinaus funktionieren kann ...
175 Jahre sind doch eine lange Zeit, um die Hochschule im Bewusstsein der Stadt zu verankern. Oder liegt das gewachsene Bewusstsein an der Zahl der Arbeitsplätze, die in jüngster Zeit im Umfeld der Hochschule entstanden sind?
Da ist in letzter Zeit sicher einiges hinzugekommen. Aber die HfG hat in ihrer Geschichte auch politisch, inhaltlich und strukturell ganz unterschiedliche Entwicklungsphasen durchlebt. Die wesentliche Zäsur ist im Grunde der Übergang von der Werkkunstschule zur Hochschule für Gestaltung als Kunsthochschule des Landes Hessen im Jahr 1970. Seitdem hat sich in der HfG, der Tradition des Bauhauses und der HfG Ulm folgend, ein neues Bewusstsein für die Integration von Kunst, Design und Medien entwickelt, das jetzt vielleicht breitenwirksamer ist und besser verstanden wird als noch vor 10, 20 oder 30 Jahren.
Offenbach ist keine typische Studentenstadt wie Freiburg, Heidelberg oder Tübingen. Wo findet denn das studentische Leben statt?
Es gibt eine vitale Kulturszene in Clubs, Bars, Ateliers und Ausstellungsräumen in Offenbach, die wesentlich von HfG-Studenten geprägt wird. Wir blicken hier nicht auf eine pittoresk-folkloristische Universitätsvergangenheit zurück wie etwa Heidelberg oder Tübingen. Mit seinem postindustriellen Umfeld, seinen Museen und der Nähe zu Frankfurt weist Offenbach eine große kulturelle und wirtschaftliche Dynamik auf. Das sieht man auch an den Start-up-Büros, Agenturen, Studios und Ateliers, die aus der HfG heraus entstanden sind. Mit dem Gründercampus ostpol wurde ein attraktives Umfeld geschaffen, um unseren Absolventen den Übergang von der Hochschule in die Berufspraxis zu erleichtern. Das ist die große Chance, zukünftig mit der Kreativwirtschaft produktiv umzugehen: Nicht nur von außen kommende Firmen anzusiedeln, sondern auch aus der Eigendynamik der Hochschule in Offenbach für einen gewissen Humus zu sorgen und Startchancen zu ermöglichen, die für HfG-Absolventen so attraktiv sind, dass sie hier bleiben. Immerhin machen sich zirka 70 Prozent unserer Absolventen selbstständig.
Wer durch Offenbach geht, findet nur wenige Hinweise auf die Kreativität der HfG-Studierenden. Die Offenbacher Welle und der Ausstellungswaggon am Main sind das eine, die jährlichen HfG-Rundgänge das andere. Was kann die Hochschule tun, um sich mehr zur Stadt hin zu öffnen?
Das ist ein zweiseitiger Prozess. Wir öffnen uns ja bereits vielfältig und sind auch wahrnehmbar. Die Stadt muss dies allerdings auch wollen und aufgreifen. Die HfG-Rundgänge mit der CrossMediaNight und der Filmnacht sind ein Beweis unserer Leistungsfähigkeit. Sie sorgen für eine große Öffentlichkeit. Aber das ist zugleich ein gewaltiger Aufwand, für drei oder vier Tage alle Räume der Hochschule, zusätzliche Außenpositionen und den gesamten Campus zu bespielen. Auf der anderen Seite braucht die HfG aber auch Orte, um sich dauerhaft präsentierem zu können. Unsere mittlerweile dreijährige Kooperation mit dem Sheraton Offenbach setzt da wichtige Akzente, denn die Ausstellung „goût“ bietet 12 bis 15 Studierenden jeweils für ein Jahr die Möglichkeit, ihre Arbeiten zu zeigen. Auch die Praxis leer stehende Immobilien zeitweise zu bespielen, bietet immer wieder viel beachtete künstlerische Kristallisationspunkte. Dennoch fehlt eine Ausstellungshalle als fester Ort und Anlaufstelle, eine permanente HfG-Galerie für die Studierenden, Lehrenden und Gäste. Das ist ein großes Manko, nicht nur für die HfG, sondern auch für Offenbach und die interessierte Öffentlichkeit. Darüber sollte man ernsthaft nachdenken, wenn man vom Kreativstandort Offenbach spricht. Zusammen mit der Kommunalpolitik müssen deshalb Wege gefunden werden, einen festen Ort zu etablieren. Denn aus eigener Kraft kann die HfG das nicht leisten.
Die HfG ist baulich eingeklemmt zwischen Gewerblich-Technischer Schule auf der einen und der Rudolf-Koch-Schule auf der anderen Seite. Reichen die Räumlichkeiten überhaupt aus?
Laut einer neuen vom Land Hessen in Auftrag gegebenen Studie
fehlen uns knapp 3 000 Quadratmeter Hauptnutzfläche. Das ist eine
ganze Menge, ungefähr das Dreifache vom Westflügel, der als Anbau
2003 hinzugekommen ist. Insofern ist für uns die Raumfrage im
Augenblick ganz existenziell. Derzeit wird ernsthaft darüber
nachgedacht, ob wir am bestehenden Standort bleiben oder ob wir
uns an einem neuen Standort weiterentwickeln können. Hessen hat
ein Hochschulbauprogramm, HEUREKA, aufgelegt, mit dem bis 2020
cirka drei Milliarden Euro für den Ausbau von Campus-Universitäten bereitgestellt werden. Und die HfG ist aufgefordert, ihre Idealvorstellungen zu formulieren und an einer Machbarkeitsstudie mitzuwirken. Das wird im ersten Halbjahr dieses Jahres passieren.
Ein möglicher neuer Standort, der im Augenblick diskutiert wird, ist der Offenbacher Hafen. Dort könnte man nicht nur einen neuen HfG-Campus, sondern eine gesamte Kreativinsel etablieren, auf der
sich auch Unternehmen der Kreativwirtschaft ansiedeln. Das ist sehr
spannend, zumal dies die gesamte Mainachse vom West- über
den Osthafen und die EZB bis hin zum Offenbacher Hafen städtebaulich und architektonisch akzentuieren würde. Die Architekten der TU Darmstadt werden im Sommer Ideen dazu als Diplomarbeiten entwickeln. Diese werden dann zum nächsten Rundgang vom 3. bis 6. Juli 2008 in der HfG präsentiert.
Was wäre Ihre Idealvorstellung: Ausbau oder Neubau?
Wenn wir heute über eine Hochschule für Gestaltung im 21.
Jahrhundert nachdenken, dann wäre es spannender, einen Neubau zu planen – ganz ohne Altlasten. Wir arbeiten derzeit in einer Art historischem Patchwork-Campus, einem Ensemble von Bauten aus unterschiedlichen Jahrhunderten rund um den Schlossplatz mit vielen räumlichen Einschränkungen. Allein unser Hauptgebäude stammt aus dem Jahr 1911, dem Anfang des letzten Jahrhunderts. Dieser historische Bau hat zwar viel Charme, wurde aber als Technische Lehranstalt der Stadt Offenbach geplant. An eine Nutzung als Kunsthochschule wurde damals nicht gedacht, und das merkt man eben bis heute. Gleiches gilt natürlich für die Umnutzung des wunderschönen Isenburger Schlosses aus dem 16. Jahrhundert, das durch den Einbau von Leichtbauwänden nachträglich für unsere Anforderungen hergerichtet wurde. Und der Neubau aus dem Jahr 2003 weist von der Konzeption in die richtige Richtung, wurde aber, wie sich jetzt herausgestellt hat, viel zu klein angelegt. Insgesamt sind das erhebliche Belastungen und Nutzungsbeschränkungen, die dieser Standort hat. Ein Neubau bietet die Chance, einen bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Kunsthochschulcampus zu planen, der als Leuchtturmprojekt Zeichen setzt und zudem Strahlkraft über Offenbach hinaus für das ganze Rhein-Main-Gebiet hätte. Auch landespolitisch wäre es ein wichtiger Akzent, weil man die Bedeutung von Kunst und Gestaltung als wichtigem Wirtschafts- und Standortfaktor im Kontext eines Kreativ-Clusters herausheben würde. Die HfG hat rund 600 Studenten in zwei Fachbereichen, Visuelle Kommunikation und Produktgestaltung.
Würde ein Neubau auch bedeuten, dass die Hochschule
ihr fachliches Angebot ausweitet?
In beiden Fachbereichen gibt es ein erhebliches Spektrum von Einzeldisziplinen, die sowohl die Bildende Kunst als auch Kommunikationsdesign, Medien, Bühnenbild, Produktdesign und einen starken Theorieanteil umfassen. Wir haben also bereits ein sehr hohes Variantenspektrum sowohl an Inhalten als auch an technischen Optionen. Denn neben den neuen digitalen Technologien betreiben wir viele Werkstätten für die analogen, künstlerischen Techniken. Grundsätzlich haben wir in sehr vielen Bereichen Entwicklungspotenzial, was sich auch in der gerade gegründeten Hessischen Film- und Medienakademie manifestiert, einem Lehr-, Forschungs- und Produktionsverbund aller hessischen Hochschulen mit Sitz an der HfG. Aber auch die Hessische Theaterakademie, das 3-DKompetenzzentrum sowie die im Aufbau befindlichen Institute für neue Kommunikation und für designorientierten Technologietransfer markieren diese Entwicklung. Insofern wäre es perspektivisch richtig, dass wir bei einer Neugründung nicht nur über die 3 000 Quadratmeter fehlende Hauptnutzfläche nachdenken, die auf unseren jetzigen Bedarf zugeschnitten sind, sondern zukünftiges Potenzial eingeplant wird, um das eine oder andere Forschungsund-Lehrgebiet ausbauen oder hinzunehmen zu können.
Diese Entwicklungsperspektive lässt sich am jetzigen Standort so gut wie gar nicht realisieren.
Wo sehen Sie derzeit die spannendsten Entwicklungsfelder?
Generell sind Kunst und Gestaltung immer spannende Entwicklungsfelder mit hoher innerer Dynamik, die durch nichts zu stoppen ist. Das gilt für die ganze HfG. Mit dem Einzug der Digitalisierung in alle Gestaltungsdisziplinen haben sich interessante Überschneidungen ergeben, bei denen sich nicht nur verschiedene Technologien, sondern auch unterschiedliche Fragestellungen durchdringen. Nehmen Sie das Internet als komplexe Medienintegrationsmaschine, in der Print, Radio und Fernsehen verschmelzen, gepaart mit datenbankgestützter Intelligenz, Interaktivität und weltweiter Verfügbarkeit. Ein riesiges Betätigungsfeld für viele unserer Disziplinen. Oder die Komplexität eines Computerspiels, das nur noch in der Zusammenarbeit vieler unterschiedlicher Spezialisten entstehen kann, wie man das vom Film her kennt. Dieser wiederum setzt an zum Sprung aus dem zweidimensionalen, rechteckigen Leinwandformat in interaktive 3-D-Raumprojektionen. Dies sind nur einige der Entwicklungsfelder, in denen es zukünftig für unsere Lehre und Forschung und auch unsere Absolventen viel zu tun gibt.
Für die Lehre und Forschung in diesen Bereichen haben Sie 2000 das CrossMediaLab an der HfG gegründet?
Ja. Traditionell enthält der Medienbereich an der HfG sowohl angewandte als auch freie Komponenten. Insofern gibt es bewusst angelegte Schnittstellen, etwa zwischen dem Kommunikationsdesign und den freien künstlerischen Disziplinen. Diese Schnittstellen werden im CrossMediaLab thematisiert, um übergreifende Zusammenhänge darzustellen. Es werden zahlreiche Projekte mit Drittmittelpartnern aus Industrie und Wirtschaft sowie mit Institutionen aus Kultur und Medien realisiert. Eine wichtige Forschungskooperation ist für uns die Zusammenarbeit mit dem Institut für Grafische Datenverarbeitung des Fraunhofer-Instituts in Darmstadt. Wir entwickeln zusammen 3-D-Simulationen und neue Interaktionsformen, die auf einer hoch auflösenden Videowand sichtbar gemacht werden. Ganz aktuell wollen wir auch unsere Pläne für die Kreativinsel und den HfG-Campus im Offenbacher Hafen so darstellen, um ein hautnahes Gefühl für diese Idee zu vermitteln.
Das klingt alles sehr theoretisch. Wie sieht das konkret aus?
Das CrossMediaLab ist beispielsweise auch als Teil eines fachbereichsübergreifenden 3-D-Kompetenzzentrums an der HfG zu sehen, das einen nahtlosenArbeitsprozess für Künstler und Gestalter in Forschung und Lehre ermöglichen soll. Das heißt, vom Konzept über den Entwurf bis zur virtuellen Simulation und zum analogen Prototyping sollen die Arbeitsschritte ineinander greifen und die 3-D Daten miteinander kompatibel sein. Lassen Sie mich das konkretisieren. Im Rahmen eines Kunst-am-Bau-Projekts hat eine unserer Studierenden für die Mainova eine Skulpturenidee entwickelt, die Daten von kleinen, handgefertigten Tonmodellen eingescannt und mittels einer computergesteuerten CNC-Fräse als überdimensionale Skulptur hergestellt. Das ist eine ganz neue Art des skulpturalen Prozesses, der ohne die zwischengeschalteten Technologien so nicht denkbar wäre. Oder in der Produktgestaltung wurden neue Möbel am Rechner entwickelt, die jetzt im Auftrag der Universität Oslo hier mit derselben CNC-Technologie gefertigt wurden zum Einsatz in der dortigen Bibliothek.
Sie haben Ihren Master am M. I.T. in Cambridge/USA gemacht, haben in Zürich und Köln gelehrt und sind 1999 an die HfG gekommen. Was reizt sie an Ihrer Aufgabe in Offenbach?
Die HfG hat seit 1970 die vom Bauhaus initiierte Agenda zur Integration von Kunst, Design und Medien sehr intensiv verfolgt. Dieser Ansatz, den ich teile, ist durch meine Zeit am M. I.T. um die Perspektive zur Integration von Kunst, Wissenschaft und Technologie erweitert worden. Als ich Anfang der 1980er Jahre in den USA war, hat sich diese Thematik durch den Beginn der Digitalisierung herauskristallisiert, sie spielt bis heute eine wichtige Rolle. Diese Durchdringung und wechselseitige Beeinflussung verschiedener technologischer Entwicklungen ist heute nicht mehr wegzudenken. Gyorgy Kepes, der Gründer des Center for Advanced Visual Studies am M. I.T., sprach schon sehr früh von einer neuen Landschaft, die aus dem Zusammenwirken von Kunst und Wissenschaft entstehen würde. Die HfG in Offenbach ist ein aktiver und sehr profilierter Ort in dieser Landschaft. Das habe ich 1999 als Herauforderung aufgefasst, ohne zu ahnen, dass ich 2006 einmal Präsident der Hochschule werden würde.
Seit 1999 sind Sie beruflich hier verankert, aber privat sind Sie nie Offenbacher geworden?
Doch, in den ersten Jahren habe ich auch in Offenbach gewohnt. Da bin ich aber noch zwischen Hamburg und Offenbach gependelt. Mittlerweile muss ich sagen, dass ich mich als hanseatisch geprägter Kosmopolit sehr wohlfühle im Großraum Rhein-Main. Ich verbringe viel Zeit in Offenbach. Bin aber auch viel national und international unterwegs, um die HfG zu vertreten und mit Kooperationspartnern zu verhandeln.
Also kein Privatleben in Offenbach?
Nur zum Teil. Ich versuche, so viele Leute wie möglich nach Offenbach einzuladen und hierher zu holen, man muss aber eben auch selbst woanders präsent sein. Das gehört zum professionellen Agieren dazu.
Was macht der HfG-Präsident, wenn er nach Hause geht?
Ich genieße die rasante Entwicklung meiner acht Monate alten Tochter Karla Mia. Koche mit meiner Frau und Freunden und nutze das kulturelle Angebot in der Rhein-Main-Region. Andererseits ist man heutzutage durch die mediale Vernetzung auch zu Hause im internationalen Zusammenhang präsent.
Viele Ihrer Besucher waren noch nie in Offenbach. Was sagen Sie ihnen über diese Stadt? Werben Sie dafür?
Natürlich mache ich Werbung für Offenbach, und selbstverständlich ist die Stadt auch immer wieder ein Thema. Allein mit unserer Präsenz werben wir für diesen Standort, die Stadt ist schließlich Teil unserer offiziellen Bezeichnung. Aber für mich sind auch die Nähe zu Frankfurt und die Positionierung im Rhein-Main-Gebiet maßgeblich. Insofern sollte man nicht zu viel Energie darauf verschwenden, Offenbach aus diesem Kontext herausgelöst zu propagieren. Ganz im Gegenteil: Offenbach ist ein aktiver Teil der Rhein-Main-Region. Und Frankfurts Oberbürgermeisterin Petra Roth ist genauso Mitglied unseres Freundeskreises wie Offenbachs Oberbürgermeister Horst Schneider Mitglied im Freundeskreis der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt ist. Für mich kann das nicht auseinandegehalten werden. Die Stärke Offenbachs liegt doch gerade in der Nachbarschaft zu Frankfurt und zum produktiven Rhein-Main-Gebiet.
Interview: Olaf Zimmermann
Fotos: Michael Ehrhart
16.04.08